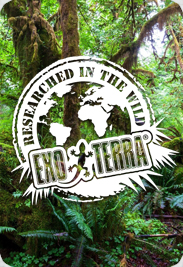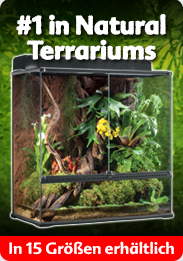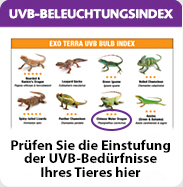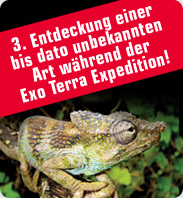Symposium Germany 2008

Wildfänge wie lange noch?
Exo Terra Symposium im Tierpark Bochum
Es ging um nicht weniger als um die Zukunft der Terraristik. Deren Image in der Öffentlichkeit ist nach wie vor schlecht und der Gegenwind von Politik und Tierschutzverbänden wird heftiger. Wie kann man Import, Zucht und Handel mit Reptilien und Amphibien als Geschäftszweig in Zukunft erhalten? Könnte ein von manchem befürchtetes Importverbot durch Nachzüchtungen aufgefangen werden? Wie kann man das Image der Terraristik verbessern?
Vor diesem Hintergrund trafen sich in der Tierschule des Bochumer Tierparks am 16. und 17. Februar Importeure, Züchter, Großhändler, Zoofachhändler und Verbandsvertreter aus dem In- und Ausland, um sich ein Bild von der Lage zu machen und Lösungen zu diskutieren.
Eingeladen hatte die Firma Hagen Deutschland, die Exo Terra im hiesigen Markt vertritt. Die Eröffnung der Veranstaltung übernahm Emmanuel van Heygen als internationaler Brand Manager der Marke Exo Terra. Durch die Tagung führten Richard Wronka, Marketingleiter bei Hagen Deutschland und Roland Zobel Produktmanager Terraristik.
Drohendem Importverbot richtig entgegentreten
Lorenz Haut, Geschäftsführer des Bundesverbandes für fachgerechten Natur- und Artenschutz e.V. (BNA) forderte, dass die Haltung wildlebender Tiere in menschlicher Obhut jederzeit möglich sein müsse. Dagegen gäbe es wachsenden Widerstand von Tierschutzorganisationen und von der Politik.
Er erinnerte an das EU-Importverbot für sämtliche Wildvögel, das unter dem Vorwand der Vogelgrippe verhängt wurde und an extreme Positionen von Tierschutzorganisationen, die sogar zoologische Gärten abschaffen wollten, indem man die Tiere dort einfach aussterben lässt. Schließlich kritisierte er das Verbot der Haltung von potentiell gefährlichen Tieren durch Privatpersonen in Hessen.
Auf der anderen Seite trat er aber auch für die Einhaltung von Standards ein, die den Tierschutz bei Import, Handel und Haltung von Wild- und Zuchttieren gewährleisten. Er zitierte in dem Zusammenhang die „Mindestanforderungen an die Haltung von Reptilien“ und die „Leitlinien zur Ausrichtung von Tierbörsen unter Tierschutzgesichtspunkten“, beides herausgegeben vom Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft.
Zum Import von Wildfängen hielt Haut fest, dass die EU zur Zeit kein generelles Importverbot von Reptilien beabsichtigt. Es sei aber ein europäisches Tierschutzgesetz geplant und in dem Kontext erforderlich, dass die Verbände der betroffenen Importeure, Züchter und Händler geschlossen auftreten.
Für Einfuhren wild gefangener Tiere schlägt der BNA folgende Regeln vor:
- Kontrollierte, nachhaltige Entnahme von Reptilien in den Herkunftsländern
- Import nur durch zertifizierte Großhändler
- Keine Massenimporte
- Förderung von Nachzüchtungen in Deutschland
- Abgabe seltener und schwierig zu haltender Arten nur an sachkundige Halter
Das gab Diskussionen, insbesondere als zusätzlich der Vorschlag auf den Tisch kam, dass Zoofachhändler nur noch nachgezüchtete Tiere verkaufen sollten. Doch es kam auch Zustimmung, weil Nachzüchtungen in der Regel nicht gestresst sind, problemlos fressen und insgesamt leichter zu halten sind.
Wildfänge und Nachzüchtungen sind kein Gegensatz
Nachzucht ist aber nicht unproblematisch und zwar aus zwei Gründen. Ökonomisch betrachtet gibt es in Deutschland keine Großzüchter und relativ wenige gewerbliche Betriebe. Die Privatzüchter machen durch Niedrigpreise den Markt kaputt, so dass ein gewerblicher Züchter Probleme hat, vernünftige Preise zu erzielen. Auf der anderen Seite beklagt der Großhandel, dass Züchter nur selten bereit sind, dem Handel nennenswerte Rabatte einzuräumen. Das führt laut Thorsten Holtmann vom Oberhausener Tropenparadies dazu, dass Händler mit diesen Tieren gegenüber Tierbörsen oder Internetplattformen nicht konkurrenzfähig wären. Da funktioniert der Markt also noch nicht richtig. Der andere Grund ist biologischer Natur.
So erläutert der Chamäleon-Spezialist Wolfgang Schmidt, dass Nachzuchten allenfalls über zwei bis drei Generationen gelingen und dann abbrechen. Wildfänge sind also allein schon erforderlich, um Züchtungen immer wieder neu anzustoßen. Fazit: Man kann nicht einfach den Wildfang durch Nachzüchtungen ersetzen.
Ein Importverbot würde auch die Herkunftsländer schädigen
Für Wildtierimport sprach zusätzlich der Entwicklungshilfegedanke, denn in einigen Ländern machen die Einnahmen aus dem Export von Tieren unterdessen einen bedeutenden Betrag aus. Und schließlich erwarte man von diesen Ländern ja auch, dass sie in den Artenschutz investieren. „Costa Rica wird keine Biotope mehr schützen, wenn damit keine Geschäfte mehr gemacht werden können“, meinte Sylvia Macina von der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde e.V. (DGHT). Außerdem werde der Wildfang gebraucht, um die Nachzüchtungen regelmäßig genetisch aufzufrischen. Heute gäbe es ja von einigen Schlangenarten im Handel nur noch so genannte Bonbontiere mit völlig unnatürlichen Modefarben – natürliche Färbungen Mangelware!
Klaus Oechsner, Präsident des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) thematisierte in seinem Vortrag die mangelnde Zusammenarbeit der Verbände angesichts der großen Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Politik. Auch er vertrat die Meinung, dass kontrollierte Naturentnahmen bleiben müssen, um die Qualität der Zuchten zu erhalten. Die aktuell bei der EU diskutierten Auflagen für Importe hält er für überzogen, das gilt insbesondere für die sechsmonatige Quarantäne im Ursprungsland. Auch er sieht mit Sorge den wachsenden weltweiten Einfluss von Tierrechtsorganisationen, die zum Teil extreme, fundamentalistische Positionen vertreten. Jede Tierhaltung, mithin auch die Heimtierhaltung werde von einigen dieser Organisationen – mit Entschiedenheit abgelehnt und bekämpft. Um gegen solche Organisationen anzugehen, helfe aus seiner Sicht nur die Geschlossenheit aller Akteure der Heimtierbranche einschließlich der Züchter. Im Vordergrund müsste dabei ein nachhaltiges Bemühen um weitere Verbesserungen beim Schutz von Heimtieren stehen, idealerweise in enger Zusammenarbeit mit den im Bündnis Tierschutz zusammengeschlossenen Tierschutzverbänden, wie dem Deutschen Tierschutzbund.
Radikale Tierschutzgruppen haben zuviel Einfluss
Der DGHT-Vorsitzende Ingo Pauler hat als Gegner vor allem die „Tierrechtsfanatiker“ im Visier, die generell gegen Tierhaltung sind. „Wenn die sich durchsetzen, droht nicht nur ein totales Importverbot, dann werden früher oder später auch Züchtungen verboten.“ Dass sei jedoch ein Angriff auf die international unstrittige Forderung nach Biodiversität und Nachhaltigkeit. Die armen Länder müssen mit Wildtierexporten Geld verdienen können, damit sie überhaupt die Mittel haben, die Biodiversität zu schützen und die Arten zu erhalten. Zertifizierte Importeure hält er auch für einen richtigen Weg. Außerdem tritt er für den Transfer von Zucht-Know-how in die Drittweltländer ein, um dort die wirtschaftliche Nutzung der natürlichen Ressourcen zu verbessern.
Chris Newman, Vorsitzender einer Tierhaltervereinigung aus England führte den deutschen Kollegen vor Augen, dass man es mit einer europäischen Problematik zu tun hat. Besonders klar wurde, dass die Auseinandersetzung mit Tierschutzverbänden, die in England noch wesentlich radikaler sind als bei uns, ein Kampf mit ungleichen Waffen ist. Die fünf größten Gruppen bringen es in England auf knapp 300 Mio. Euro Spendenvolumen. Da können Handel und Züchter nicht mithalten, selbst wenn sie von der Industrie unterstützt würden. Newmans Rat war dann auch, über Presse- und Lobbyarbeit mit gut recherchierten Argumenten zu kontern. Er ließ z.B. untersuchen wie viele von den zigtausend Tierunfällen in England mit Reptilien passiert sind. Es waren ganze 18, der Rest entfiel auf Hunde, Pferde, Katzen usw.
Trotz der schwierigen Lage der Branche gab es innerhalb des Symposiums keine Einigkeit über die Zusammenarbeit der verschiedenen Verbände. Während Lorenz Haut vom BNA die Meinung vertrat, man müsse mit allen reden, auch wenn man völlig anderer Meinung sei, war Ingo Pauler für Kompromisslosigkeit. „Nicht immer mit allen reden, keinen Fußbreit zurückweichen!“
Bei den Teilnehmern im Plenum war der Wunsch nach Einigkeit deutlich zu spüren und wie man hört, hat es im Anschluss an die Tagung doch noch eine Verabredung gegeben, sich zu den brennenden Themen zusammenzusetzen.
Was ist zu tun?
Die Zukunft der Terraristik ist ungewiss. Für eine gute Zukunft müssen drei Dinge sichergestellt werden. Zunächst, dass alles absolut sauber abläuft in Import, Zucht und Handel. Warum nicht wie in anderen kritischen Branchen auch, den Weg der Zertifizierung bei Importbetrieben und Züchtern gehen? Volker Ennenbach vom Großhandel Tropenparadies forderte ausdrücklich eine Lizenzierung aller Importeure von Lebendtieren. Falls das EU-weit nicht funktionieren sollten, tritt er für ein Gütesiegel ein, das Mindeststandards garantiert. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und führt uns zum zweiten Punkt. Die heute verfügbaren hochwertigen Techniken zur Ausstattung von Terrarien müssen überall genutzt werden. Ennenbach fragt, ob in vielen Fällen der Zoofachhandel seine Terrarienanlagen nicht technisch aufwerten müsste. Die Alternative wäre der Verzicht auf den Handel mit bestimmten Arten. Schließlich und drittens ist es erforderlich, die Bemühungen und Erfolge einer breit angelegten Qualitätsoffensive auch in Politik und Öffentlichkeit zu kommunizieren. Und das möglichst mit einer Stimme!